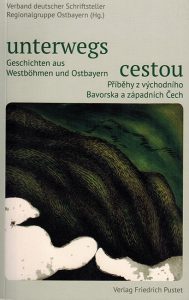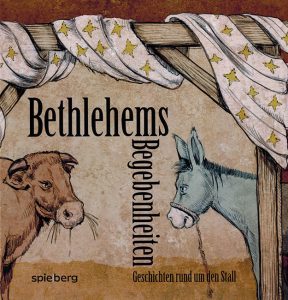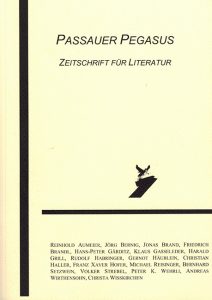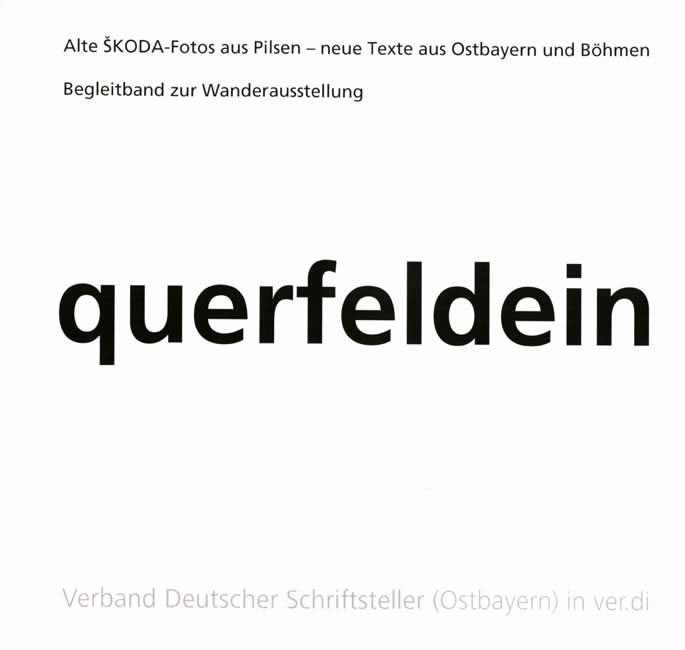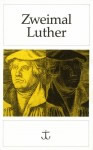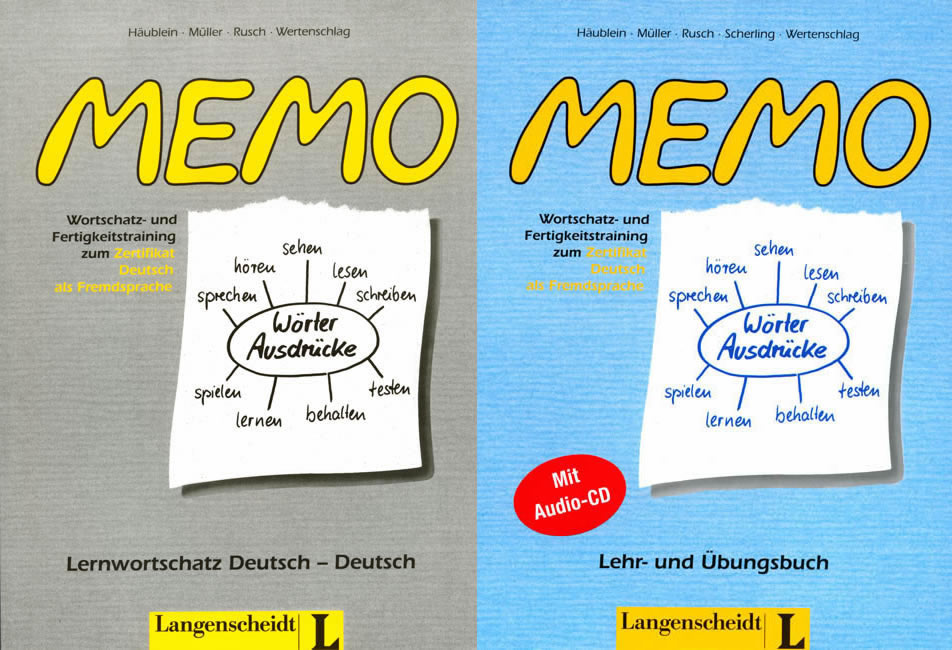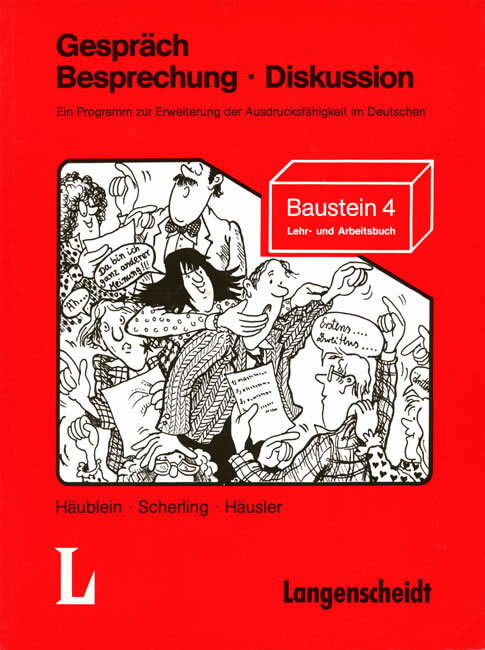Leseprobe 1
aus meinem im September 2022 veröffentlichten Roman:
DIE GEHORSAMEN. Dokumentarischer Roman über drei deutsche Familien 1879 – 1949
Kapitel 3: Kind der Schande
Kaum zehn Jahre später, Januar 1914. Kein kalter Winter, man kann den Frühling schon riechen an manchen Föhntagen, wenn der Himmel türkis und weiß gefiedert ist.
In dieser Zeit besichtigen Kaiser, Könige und Admiräle ihre Schlachtflotten, beugen sich Feldmarschälle über Aufmarschpläne, legt der Industrieadel seine Rüstungsrenditen in Gold und Schweizer Franken an.
In diesen Wochen wirbelt am Rhein der Karneval, am Main und an der Isar tobt der Fasching. Die Tanzveranstaltungen sind überfüllt wie noch nie, die Masken fantastischer, die Menschen dahinter leidenschaftlicher und begeisterter als je. Viele spüren dunkel, dass etwas Riesenhaftes bevorsteht, sehen Schwarzweißrot, „schimmernde Wehr“ oder „Stahlgewitter“, gleichviel, wie ein hohes Altarbild.
Dora Türk und Anton Roth kommen aus benachbarten Dörfern am oberen Main, sie sind beide 19, in evangelischer Strenge erzogen. Sie kennen sich aus dem zweijährigen Präparanden- und Konfirmanden-Unterricht, haben einander nach der Konfirmation aus den Augen verloren.
Anton Roth hat nach der Schulzeit zwei Jahre als Knecht in der Landwirtschaft des Barons von Künßberg gearbeitet und wenig Geld verdient. Mit gerade 17 Jahren, im Herbst 1911, hat er sich freiwillig zum Militär gemeldet und auf zwölf Jahre verpflichtet. Gelandet ist Anton bei den „Leibern“, dem Königlich-Bayerischen Infanterie-Leibregiment in München, einer Elitetruppe, von der man im weißblauen Königreich mit Hochachtung und Stolz spricht.
Auf Heimaturlaub nach Oberfranken kommt er Anfang 1914 in der schwarzroten Ausgehuniform eines Unteroffiziers und zieht bewundernde Blicke auf sich. Das Ehrenkleid der Nation hat magnetische Kräfte: Nicht nur die jungen Mädchen fliegen auf „stramme Soldaten“.
Dora Türk hilft der Mutter, zusammen mit ihren Schwestern und Brüdern, das ärmliche Bauernzeug in Mainleus über Wasser zu halten, das der Vater fast ganz versoffen und verspielt, schließlich in höchster Geldnot für ein Darlehen an einen reisenden jüdischen Viehhändler und Geldverleiher verpfändet hat.
Im Januar 1914, auf einem Faschingsball im Saal eines der Mainleuser Dorfgasthäuser, inmitten des derben Maskengetümmels, treffen Dora und Anton aufeinander: Walzer mit Partnerwechsel. Nur eine Runde dürften sie eigentlich miteinander tanzen –, aber nach diesem kurzen Tanz loslassen, das geht einfach nicht, vergessen sind die Regeln. Während sie sich schwindlig drehen, während Anton über seinen lustigen und ärgerlichen Kasernenalltag schwadroniert, sagt Dora wenig, schaut ihn genau an und denkt sich viel:
‚Wie trocken und warm seine Hände sind, die Uniform ist schneidig, passt zu ihm, wie er sich verändert hat seit damals, ich spür’ lange feste Muskeln an seinem Arm, er hat’s geschafft, ist weg von zu Haus’, er steht auf eigenen Beinen, zu Besuch würd’ ich auch lieber heimkommen, aber wo sollt’ ich denn hingeh’n? Ich hör’ ihm gern zu, er plaudert wie ein Bub und ist dabei schon Soldat, hoffentlich gibt’s nie einen Krieg, solang ich leb’, wie leicht er tanzt, noch nie bin ich so geschwebt …‘
Der Unteroffizier Johann Georg Roth spürt, dass sich etwas wiederholt, was doch vorher noch nie gewesen sein kann. Er erinnert sich an die oft gehörte Geschichte, wie seine Mutter und sein Vater einander kennengelernt haben, damals im Gut Oberau, beim Tanz. Und dass der Vater Jude war und … . Ein starkes Gefühl strömt aus seiner Hand auf Doras Rücken. Sie riecht nach Kernseife und Wäsche von der Leine, ihre Augen sind taubengrau und ein wenig traurig, obwohl sie lächelt, mager und fest fühlt sie sich an, sie arbeitet viel auf dem Feld und im Stall, aber nur noch eine Kuh und ein paar Ziegen haben sie …
Längst sind Walzer und letzte Runde vorbei, der Saal hat sich geleert, der Heimweg zu Doras Elternhaus ist ihnen viel zu kurz. Sie gehen einen Umweg, unten am Main entlang. Dora zeigt ihm im eisblauen Mondlicht den Platz, wo zu Frühjahrsbeginn die Flöße zusammengebaut werden, mit denen der Vater ‒ ‚Der Lump! Der Säufer!‘, denkt sie ‒ und die anderen Flößer jedes Jahr den Main und den Rhein ganz hinabfahren bis nach Rotterdam. Der Vater kommt spät, im Juni oder Juli, mit Schulden zurück statt mit gutem Geld für gutes Holz …
„Die große Reise beginnt hier, bei uns!“, sagt sie, trotzdem sehr stolz. „Und dort oben wohn’ ich.“
Der spitze Giebel eines Bauernhäuschens wird langsam sichtbar, während sie den schmalen, steilen Wiesenweg hinaufsteigen, Dora voraus, Anton dicht hinter ihr, sie hört ihn heftig atmen und er sie. Als sie fast an der Gartentür sind, die Zaunlatten schwarz und scharf zu sehen wie ein Eisengitter, dreht sie sich um und fasst nach seiner Hand:
„Magst du mich? Nimmst du mich mit, weg von hier, weit weg? Ich halt’s hier nimmer aus!“
Sie weint plötzlich, Anton versteht nicht, legt seine Uniform-Arme um sie wie einen schwarzen Mantel. Lang stehen sie so, Dora wird still.
„Ja, wohin du willst“, sagt er leise.
„Komm“, flüstert sie, „da hinein, da ist’s wärmer“ und zieht ihn durchs geöffnete Gartentürchen zu einem niedrigen Bau abseits vom Wohnhaus, der sich an die schwarze Masse des benachbarten Gutshofes von Johann und Margareta Schwarz lehnt. Drinnen riecht es aromatisch warm nach Kuh und Milch, es gibt Heu zum Hinsetzen, nur blasses Mondlicht sickert durch zwei flache Oberlichter in den Stall.
Anton fällt sofort die Weihnachtsgeschichte ein, die er erst vor wenigen Wochen, wie jedes Jahr, gehört hat, Luthers Wortgebirge, gewaltig im Klang wie ein Orgelstück, intoniert vom Pfarrer auf der Kanzel:
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging …“
‚Nur der Esel und das Kind fehlen‘, schießt es ihm durch den Kopf.
Lange sitzen sie still, Dora zittert und denkt an ihre Mutter, die sicher nicht schläft und im Bett lauschend auf sie wartet – da spürt sie seine Hand an der Brust und seine Lippen auf ihrem Mund. Sie ist überrascht, plötzlich tief aufgewühlt, sie schwankt zwischen einem ungekannten Glücksgefühl und schierer Angst. Dora fühlt, er wartet auf ihre Antwort, sie zögert, will ihn zurückschieben ‒ dann gibt sie doch nach, das Heu riecht herb und süß.
Erst drei Monate später, im April 1914, sahen sie sich wieder. Viele Briefe hatten sie gewechselt, Dora passte immer heimlich den Postboten ab, damit die Mutter keinen Verdacht schöpfte. Denn Barbara Türk hatte nicht nur ihren Mann Konrad satt, den verzweifelten Säufer und Spieler, sie schloss auch alle anderen Herren der Schöpfung mit in ihr Urteil ein, vernichtend und endgültig.
„Lasst die Finger von den Männern!“, sagte sie ihren Töchtern immer wieder, „Die taugen alle nix!“
Und die drei Mädchen blinzelten sich zu, jede dachte an ihren Verehrer, die bitter ernst gemeinten mütterlichen Ermahnungen erreichten sie nicht.
Als Dora im Februar und auch im März vergeblich auf ihre Monatsblutung wartete, verfinsterte sich ihr der Himmel von Tag zu Tag, obgleich draußen das Licht täglich zunahm und die Luft immer häufiger nach Frühling roch. Sie schrieb Anton nichts von ihren Sorgen, nur kürzer angebunden, einsilbiger wurde sie von Brief zu Brief. Er spürte die aufsteigende Finsternis, verstand jedoch nichts Genaues, fragte auch nicht nach in seinen Briefen, versuchte stattdessen sie aufzuheitern:
Bald hab ich Urlaub, dann sehn wir uns jeden Tag, ich freu mich so!
Sie hatten sich am Hügel über dem Dorf verabredet, wo die ansteigenden Äcker von querlaufenden Schlehenhecken und Baumreihen aufgefangen wurden. Nur noch ein einziges schmales Feld dort gehörte zu Doras Elternanwesen; die Wintergerste hatte kräftig ausgetrieben, Kulmbacher Mälzereien brauchten viel davon für die großen Brauereien, aber sie zahlten schlecht.
Anton musste auf Dora warten. Er saß am Feldrain vor einer blühend weißschwarzen Schlehenmauer und blickte auf das Dorf und die großen Spinnereihallen hinunter, die der Kommerzienrat Hornschuch an der Bahn entlang hatte errichten lassen. Viele Dorfleute arbeiteten dort, der „Herr Direktor“ hatte sogar eine eigene Wohnsiedlung mit Gasthaus und Kindergarten für seine Arbeiterfamilien gebaut. Von der Landwirtschaft und der Flößerei allein konnten in Mainleus, wie überall am oberen Main, nur noch wenige leben.
Anton sieht Dora sofort, als sie hinter der Böschung am Bahndamm auftaucht. Sie trägt Arbeitskleidung, Kittelschürze und Kopftuch, sie geht nicht schneller, blickt nicht auf, als er den Hang hinab ihr entgegenläuft. Anton merkt erst etwas, als er sie in die Arme nimmt: Sie fühlt sich steif und kalt an.
„Was ist?“, fragt er, „Freust’ dich gar nicht?“
„Doch“, sagt sie leise, „nur …“
Und sie erzählt, dass sie ein Kind bekommt, von ihm, die Nacht im Stall …
Anton ist wie betäubt, spürt eine ganze Zeit lang gar nichts. Dann kehren seine Gefühle zurück, eine seltsam flackernde Begeisterung steigt auf:
„Ja, gut, dann wird eben geheiratet! Ich kann dich doch ernähren, als Unteroffizier!“
„Und du meinst, es reicht für uns drei?“, fragt Dora zurück.
Er schließt sie ganz fest in die Arme, beruhigt sie:
„Ja, ja, ganz bestimmt …“
Sie treffen sich jeden Tag, die ganze Urlaubswoche lang, oben am Feldrain. Sie reden und schweigen auch viel: Die Schwangerschaft, ihre Zukunft, die Eltern, die Leute bei ihr und bei ihm im Dorf, die wachsende Angst vor einem großen Krieg in Europa machen ihnen Sorgen. Aber immer zugleich halten sie sich fest an dem hoffnungsvollen Bild einer Zukunft, die sie entschlossen sind zu teilen: die geplante Hochzeit, das Kind, eine gemeinsame Wohnung – und die sogar in der Hauptstadt München!
Sie verabreden, dass Anton bei seinem nächsten Urlaub um ihre Hand anhalten wird, wie sich’s gehört. Und im Sommer wird dann geheiratet.
Dora steht nicht am Bahnsteig, als die kleine Dampflokomotive den Personenzug anzieht, mit dem Anton zurück zur Münchener Garnison fährt. Sie winkt stattdessen von der Wiesenböschung, hinterm Haus der Tante, mit ihrem Kopftuch. Und er ruft ihr aus dem weit offenen Abteilfenster etwas zu, was sie nicht versteht, er schwenkt die Pickelhaube lange, bis Doras weißes Tuch und das Dorf versunken sind hinterm Bahndamm.
Aus Doras rechter Hand hängt schlaff das Tuch, ihre Linke krampft sich um ein kleines, in Rotgold gefasstes Medaillon. Anton hat es ihr beim Abschied verlegen in die Hand gedrückt; es zeigt ihn als braun-weiße Fotografie, jung, ernst, in Ausgehuniform und Helm, so, wie er gerade im Zugfenster gestanden hat.
Die schlanke junge Frau steht lange, schaut dem bildlosen Zug nach, bis der Geruch des Kohlenrauchs verweht ist. Sie setzt sich ins höher werdende Gras am Hang und weint, leise erst, dann wird das Schluchzen tiefer und wilder, der Schmerz erstickt sie fast, Angst schüttelt sie:
‚Was soll das mit uns werden? Das geht nicht gut. Ich fürcht’ mich so!‘
Mit diesem Wirbel von Gefühlen im Bauch, wo sich manchmal schon etwas bewegt, steht Dora auf und geht heim durch den Garten der Tante. Die Mutter wartet auf sie. Der Vater ist krank, kann nichts mehr arbeiten, sie wird daheim gebraucht.
Als Dora die Klinke der Haustür drückt, spürt sie, dass die Mutter nicht allein ist. Eine ungute Ahnung steigt auf:
‚Uns wird doch niemand gesehen haben ‒ ?‘
In der Küche sitzt, am Tisch vorgebeugt, nah bei der Mutter, eine Nachbarin, die schlimmste Klatschtante des Dorfes ‒
‚Grad die!‘
Die Mutter ist blasser als sonst, schaut ihre Tochter nicht an, als die eintritt und grüßt und unsicher stehen bleibt. Schweigen, unerträglich, erstickend. Dora weiß sofort: Das abgebrochene Gespräch ist um sie gegangen und um den Anton!
Schnell verabschiedet sich die Nachbarin, mit schrägem Blick nach unten auf den Bauch der 19-Jährigen. Die Mutter bleibt schweigend sitzen, endlos lang. Dann sagt sie:
„Setz dich!“
Diese zwei Wörter lösen in Doras Kopf einen Film aus, der rasend schnell rückwärts läuft, bis sie sich als Schulmädchen sieht, neun oder zehn Jahre alt, karierte Kittelschürze, lange dünne Zöpfe, barfuß vor dem unbarmherzigen Oberlehrer Hetz stehend. Sie ist zu spät zur Schule gekommen, ein paar Minuten nur, wegen der Stallarbeit am Morgen. Er hat die dünne Weidenrute noch in der Rechten, die sich dreimal in ihre offene kleine Hand eingebrannt hat, für immer … . Er sagt mit schneidendem Ton: ‚Setz dich!‘
„Ich muss mit dir reden“, sagt die Mutter endlich.
Wieder langes Schweigen. Dann kommen die wasserblauen Augen der Barbara Türk hoch, suchen den Blick der Tochter, prüfend, tief beunruhigt. Es kommt die Frage, mitten ins Herz, Dora hat sie erwartet und verliert doch fast das Bewusstsein:
„Stimmt’s, dass du eine Liebschaft mit dem jungen Roth aus Veitlahm hast?“
„Ja.“
„Seit wann?“
„Kurz erst.“
Schweigen wieder, erdrückend wie ein Albtraum. Dora spürt, es wird noch viel schlimmer kommen. Endlich spricht die Mutter, zögert nach jedem Halbsatz, zu schwer wiegt jedes Wort:
„Weißt du, … dass der Vater … von deinem Roth … ein Jud ist, … aus der Coburger Gegend?“
Das Herz bleibt Dora stehen, rast dann los, kein Gedanke, Dunkel explodiert, alles löst sich auf, fliegt auseinander, die Erde schwankt, als sei Krieg —
„Der Anton – ein Jud?“, flüstert sie stimmlos, nicht an die Mutter gerichtet, die hört es kaum. Doras Gedanken laufen davon: ‚Ein Jud wie der Viehhändler, dem unser Haus und Grund und Vieh gehört, der uns beim nächsten Zinstag ins Armenhaus schicken wird? Nein, nie, nie!!!‘
Sie schaut die Mutter an und erkennt, dass die an dasselbe denkt:
‚Der Vater, der alles verspielt und versäuft, weil er sieht, er kann die Familie nicht ernähren, seinen Kindern keine Zukunft geben. Und dann immer wieder die Besuche des Juden, dem erst das Vieh, dann die Felder, am Schluss das Haus und der Stall verpfändet werden, ganz korrekt, mit Brief und Siegel, gegen ein paar tausend Goldmark Kredit bei jährlichen Zinsen. Die sind zwar nicht so hoch wie bei der Bank in Kulmbach, aber wir können sie niemals zahlen – wenn uns nicht wieder die Tante aus der Stadt hilft …‘
Ohnmacht, Scham, Abscheu, Zorn schütteln die zwei Frauen, sie sind sich in dieser Agonie plötzlich so nahe, wie sie vorher einander fremd waren in der Beziehung zu Anton Roth. Ihre Sehnsucht nach sicheren, sauberen, geordneten Verhältnissen fühlen beide von allen Seiten bedroht, von innen und von außen. Und die allergrößte Bedrohung ist für sie jetzt DER JUD:
‚Der Wucherer, der Blutsauger!‘
In diesem Augenblick sieht sich Dora mehr auf der Seite der Mutter, der Geschwister, sogar des Vaters, den sie im Stillen schon so oft verwünscht hat – auf der anderen Seite sieht sie im gleichen Moment Anton mit gesenktem Blick dastehen und hinter ihm, im Halbdunkel, den breit grinsenden jüdischen Viehhändler, seine schwere Hand auf Antons Schulter … . Dora will zu Anton hin, will ihn wegreißen von dem Anderen – da hält sie das in Trauer und Widerwillen erstarrte Gesicht der Mutter zurück —
Das schmerzende Bild löst sich auf, verbrannt von einem Höllengedanken:
‚Der Mann, den ich lieb hab’ über alles – ist der Sohn von einem Juden! Und er hat’s mir nicht gesagt, er hat mich betrogen, verführt, ausgenutzt … und unser Kind, mein Kind, ein Judenkind! – LIEBER GOTT, hilf mir doch!’
Die Sinne schwinden Dora, sie stürzt vornüber vom Stuhl, schlägt sich die Stirn blutig am Küchentisch. Die Mutter schreit nach den anderen Töchtern, zu dritt tragen sie die Bewusstlose ins Bett, die Holztreppe hinauf, vorbei an der Schlafkammer des Vaters, der röchelnd seinen Rausch vom letzten Wirtshausabend ausschläft.
Der Unteroffizier Anton Roth in München bekommt fünf Briefe lang keine Antwort aus dem Fränkischen. Endlich, nach Wochen, ein dünnes Kuvert, Doras Schrift. Er reißt es auf, verschlingt die wenigen Zeilen, totenbleich wird er beim Lesen:
Du hast mir nicht gesagt, dass dein Vater ein Jud ist. Alle haben es gewusst, nur ich nicht! Und das Kind ‒ das ist die allergrößte Schande, die du mir antun konntest!
Es ist alles aus. Ich kann dich nicht heiraten, unser Hof ist an einen jüdischen Geldverleiher verpfändet. Und ich will dich nicht mehr sehen, nie mehr!
Schreib keine Briefe mehr, bitte.
Dora
Der Schmerz wirft ihn um, er liegt am Boden, Tränen strömen ihm übers Gesicht. Alles schwarz, leer, verschwunden die junge Frau am Bahndamm, gelöscht der stramme Soldat im Abteilfenster, übrig nur der Judensohn, der kein Christ sein darf wie alle andern, in Schande ausgestoßen die Judenhure und ihr Balg, das schmalhändige Glück von ein paar Winter- und Frühlingstagen ausgewischt …
Als Anton zu sich kommt, ist es Abend. Er weiß jetzt, was er tun wird:
‚Sofort Urlaub nehmen, heimfahren, mit Dora sprechen, bei ihren Eltern um sie anhalten, sie mit unserem Kind ehelichen! Es muss alles noch gut werden!‘
Der Kompaniechef, dem Anton sein dringendes Urlaubsgesuch persönlich vorgetragen hat, schaut ihn lange schweigend an.
„Heiratsurlaub wollen Sie, Roth? Wo denken Sie denn hin? Jetzt, wo jeden Augenblick der große Krieg losbrechen kann, wo wir vielleicht schon in ein paar Tagen ins Feuer geschickt werden? Welchem armen Mädel wollen Sie das antun, dass es nach ein paar Wochen oder Monaten als Witwe in Schwarz geht? – Überhaupt: Wir haben Urlaubssperre, Gesuch abgelehnt, wegtreten!“
Anton taumelt, stolpert hinaus. Für ihn ist der Krieg längst ausgebrochen: Hinter ihm, wo er herkommt, steht alles in Flammen. Und vor ihm hängt schwarzer Rauch in der Luft, tosender Kanonendonner, Schrappnell-Geheul.
Zurück im Quartier findet er sich zum Glück allein, die Stubenkameraden nutzen den vielleicht letzten Münchener Ausgang. Jetzt hat Anton nur noch eine Hoffnung. Er holt Schreibpapier, Federhalter, Tinte aus seinem Spind und setzt sich an den Tisch. Er weiß, er schreibt um sein Leben.
Liebste Dora!
Nach deinem Brief war ich wie tot und ich bin’s noch!
Warum hast du mir nicht eher erzählt, dass euer Hof an einen jüdischen Viehhändler verpfändet ist? Ich hätt dir erklären können, dass ich damit nichts zu tun hab. Und ich bin ein Deutscher und getauft wie du! Was sollen da die alten Geschichten, dass mein Vater ein Jud war in seiner Jugend? Er ist Christ geworden, weil er eine Christin geliebt hat, er hat seine Eltern und Geschwister verlassen − nie mehr gesehen hat er sie! Und er hat beim Baron, der ja nur gut Evangelische anstellt, bis zu seinem Ruhestand gedient.
Lass dich nicht verrückt machen von den Tratschweibern! Ich gehör zu dir und zu unserm Kind − erzähl ihm, dass ich Soldat bin und gar keiner mehr sein will, sondern heim möcht zu euch.
Der Leutnant hat gesagt, dass es bald Krieg gibt, und hat mir den Urlaub abgeschlagen. Ich wollt zu dir fahren und um dich anhalten, damit alles gut wird. Aber ich kann nicht, außer ich desertiere. Darauf steht die Todesstrafe.
Trotzdem, ich wüsst einen Ausweg: Komm du nach München! Hier redet niemand schlecht über uns. Ich such uns eine Wohnung, und wir heiraten gleich. Weißt du noch, im Winter an eurem Gartenzaun hast du mich gefragt, ob ich dich mitnehm, weg von daheim? Jetzt ist es so weit, ich halt mein Versprechen – komm!
Du musst mir glauben, dass ich dich und unser Kind lieb hab wie nichts auf der Welt. Schreib mir bald und komm, bevor’s zu spät ist!
Dein dich immer liebender Anton
Dora liest den Brief im Stall, wo sie mit Anton gelegen hat in ihrer einzigen Liebesnacht. Dort ist es jetzt hell und kalt, die letzte Kuh ist weg, der jüdische Geldverleiher hat sie abgeholt als Anzahlung auf den Jahreszins. Sie verkaufen nun auch die Milch ihrer drei Geißen, notgedrungen, unter anderem an die wohlhabenden Nachbarn im Gutshof; in einer kleinen Milchkanne trägt Dora sie aus, die ist schwarz und weiß gesprenkelt, mit rostigen Stellen, wo das Email abgeplatzt ist.
Als sie heute die Milch hinübergebracht hat, da hat die Nachbarin erzählt, dass ihre älteste Tochter Trina mit ihrer Familie jetzt in der Pfalz wohnt, ganz nahe an der französischen Grenze. Und dass Trina Angst hat davor, ihr Mann könnte bald zum Militär eingezogen werden, „wenn’s gegen die Franzosen geht“.
Das und vieles mehr schießt Dora gleichzeitig durch den Kopf, während sie Antons Brief wieder und wieder liest:
‚Ob er sich nur – typisch jüdisch? – drücken möcht’ vor dem Heimfahren und dem Heiraten? Oder tu’ ich ihm Unrecht? Ich hab’ Angst, dass ich das letzte Stückchen Sicherheit verlier’, das Elternhaus, die Familie, wenn ich zu ihm nach München geh’. Und überhaupt, vielleicht ist er ja jetzt schon in Frankreich?‘
Der Strudel widersprüchlicher Gefühle lähmt sie. Dazu kommen die wilden Gerüchte, die im Dorf um ihren Geliebten kreisen und ihr den Kopf schwindlig machen: Sie sei nicht die erste, er habe schon mehr junge Mädchen ausgenutzt und sitzen lassen; überhaupt würden Juden christliche Frauen nur benutzen, aber niemals ehelichen; außerdem sei Anton lungenkrank – der Doktor habe das selbst gesagt – und dürfe überhaupt nicht heiraten, deswegen sei er auch nach München verschwunden …
Da beschließt Dora, ihre Schwestern ins Vertrauen zu ziehen, sie um Rat zu fragen. Die Brüder wollen ohnehin keine „Weibergeschichten“ hören, sie arbeiten tagsüber schwer ‒ einer beim Schreiner, die anderen zwei in der Spinnerei ‒ und abends auch noch auf dem armseligen elterlichen Hof, die Erntezeit beginnt bald, der Sommer ist drückend heiß.
Mathilda und Lina sind einige Jahre älter als Dora, jede hat einen Verehrer, der eine ist ein kleiner Bauer vom Jura, der andere ein junger Baumeister, der davon träumt, die Quadratur des Kreises endlich mathematisch präzise zu lösen. Sie haben der jüngeren Schwester zugehört, Antons letzten Brief gelesen, das rotgoldene Medaillon in der Hand gewogen, geschwiegen, die Gesichter gesenkt, keine sagt etwas, Dora wartet.
„Ich glaub’ nicht, dass er ein Lump ist“, sagt Lina endlich. „Aber heiraten kannst ihn hier nie – und nach München geh’n, ich hätt’ Angst davor …“
Da fährt Mathilda auf:
„Ein anständiger Mensch nutzt kein Mädchen aus, das noch gar nichts weiß vom Kinderkriegen, und verschwindet dann, weit weg, und lässt sie allein sitzen! Da merkt man, dass er halt doch ein Jud ist, die haben die Geilheit und die Betrügerei im Blut. – Ich tät’ die Finger von ihm lassen, auch wenn er dreimal Unteroffizier wär’ und schöne Briefe schreibt!“
Die Schwestern reden noch lange, auch über die Zukunft und den drohenden Krieg und die Männer, die ihnen den Hof machen. Dora hört zu, spürt manchmal eine Bewegung ihres Kindes im Bauch, es friert sie bis ins Herz, sie hat sich entschieden.
Immer wieder betrachte ich das Bild von Anton Roth im Medaillon, Braun auf Sandweiß, Kriegsjahr 1914. Er blickt melancholisch ins Abseits trotz Gala-Uniform und Pickelhaube – ihre Spitze hat sich in die goldene Fassung gebohrt und bleibt für immer darin stecken.
Es ist Nacht, die Hügel am Fluss sind schwarz übermalt. Wolken, aufkommender Wind, Wetterwechsel.
Leseprobe 2
aus meinem Roman-Projekt FINALE. Ein Roman über die Zukunft des Lebens
Kapitel 1
Vier Wochen, nachdem die AKTION LEBEN ihr Konzept für die Zukunft des Lebens auf dem Planeten Erde und für einen möglichen globalen Exodus veröffentlicht hatte, landeten auf der farbig markierten Betonpiste hinter dem Luxushotel Abundancia***** in der chilenischen Atacama-Wüste kurz nacheinander mehrere Helikopter, Personaldrohnen und Kleinjets. Diesen entstiegen distinguierte Damen und Herren mittleren und höheren Alters mit Lederköfferchen – betont leger, aber erlesen gekleidet. Sie begaben sich zielstrebig in die Lobby des Hotels, wo man einander mit wissendem Lächeln begrüßte und im Stehen an einem Glas Champagner oder Scotch nippte. Dann erschien der Hotel-Manager und bat die Herrschaften in den reservierten Konferenz-Saal.
Als alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz ihre Plätze eingenommen hatten, die massiven Türen des Saals geschlossen und davor – innen wie außen – je drei Security-Männer postiert waren, erhob sich an einer Stirnseite des Konferenztisches ein braun gebrannter Herr mit grau meliertem Haar in blauem Blazer, heller Hose und hellblauem Poloshirt. Don Myers nickte mehreren Gästen lächelnd zu und begann dann zu sprechen:
„Liebe Plenumsmitglieder der GESELLSCHAFT! Ich begrüße Sie zu unserer außerordentlichen Konferenz und danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie alle – in der Tat alle Eingeladenen! – erschienen sind. Der Anlass ist Ihnen bekannt und in seiner globalen Bedeutung bewusst: die enormen Erfolge der sogenannten AKTION LEBEN, die unsere Interessen zumindest ebenso vital bedrohen wie die historischen Krisen am Ende beider Weltkriege, beim Abbau des „Eisernen Vorhangs“ in Europa 1989/90, durch die internationalen Währungs- und Banken-Zusammenbrüche in den Jahren nach 2010 sowie durch die beinahe erfolgreiche Revolte gegen unseren dritten Präsidenten in den USA einige Jahre danach. Der Vorstand der GESELLSCHAFT hat zum Thema AKTION in den letzten Wochen mehrfach getagt. Er hat sich schließlich vor wenigen Tagen einstimmig auf folgenden Vorschlag an dieses Plenum geeinigt – ich verlese: ‚Der Vorstand fordert das Plenum der GESELLSCHAFT mit höchster Dringlichkeit auf, die Pläne der sogenannten AKTION LEBEN unter Einsatz aller verfügbaren Mittel weltweit zu bekämpfen sowie ihre Aktionsmöglichkeiten und Handlungen konsequent zu blockieren.‘“
Myers pausiert kurz, lässt den Text wirken, fährt dann in geschäftsmäßigem Ton fort:
„Nun, meine Damen und Herren, welche konkreten Schritte schlagen Sie vor?“
Lange Sekunden gespanntes Schweigen, dann meldet sich der pakistanische Syndikatschef Abdul al-Albani zu Wort:
„Wir haben im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte immer die besten Erfahrungen mit den macht- und geldgierigen Militärs gemacht. Wir sollten diese gute alte Karte spielen, bevor die AKTION Militär und Waffen ganz abschafft …“
Sofort greift eine Dame mittleren Alters ein, die während al-Albanis Worten konzentriert das Display ihrer Armbanduhr studiert hat:
„Nein, das ist strategisches Mittelalter. Wir haben schon genug Versager-Militärdiktaturen, zerfallene Staaten und Sozialrevolutionen im Gefolge von Militärputschen gesehen! Wir leben und agieren im post-analogen, vielleicht auch schon im post-irdischen Zeitalter. Deshalb können und müssen wir diese arrogant-erfolgreiche AKTION mit ihren eigenen Waffen schlagen: im Internet, in der digital vernetzten Wirtschaft, in den medial beherrschbaren Parlamenten und in jedem für uns erreichbaren Wohnzimmer.“
Diese scharfe Intervention der CEO ihres weltweit dominierenden IT-Konzerns GAF.Universe, Sara Hinds, lässt die Spannung im Raum spürbar steigen, als sei dadurch spontan die Bildung zweier unsichtbarer Lager entstanden. Darauf reagiert der Vorsitzende Don Myers sofort:
„Ich erlaube mir Sie alle daran zu erinnern, dass wir uns in der initialen Gesprächsphase des Sammelns, Vergleichens, Diskutierens befinden – nicht in der Phase der Entscheidungen oder gar Aktionen. Ich bitte um weitere Vorschläge.“
Nun melden sich in schneller Folge viele der anderen teilnehmenden Personen und präsentieren ihre – offensichtlich vorbereiteten ‒ Überlegungen:
„Lassen Sie uns den mühsamen, aber sicher lohnenden Weg über die 360 Mitglieder der sogenannten ‚Versammlung‘ und im Gefolge auch über den ‚Zwölferrat‘ der AKTION gehen –hochattraktive wissenschaftliche Projekte, durchaus thematisch mit denen der AKTION verwandt, Spitzenpositionen in der Wirtschaft, Stipendien, Lehrstühle an internationalen Hochschulen, Beraterverträge, Forschungsaufgaben und -reisen. Wir haben dafür ja alle Ressourcen …“
Dezenter Beifall im Plenum. Ein weiterer Beitrag:
„Meine Gruppe möchte diesen begrüßenswerten Vorschlag ergänzen durch einige Ansätze zur politischen Basisarbeit. Beispiel 1: Die gesetzeskonforme Übernahme des sogenannten ‚Konzepts‘ der AKTION bedarf in vielen Ländern und Staatenbünden der Zustimmung oder gar Ratifizierung durch die zuständigen Parlamente. Hier sollten wir bei den Parlamentariern durch unsere Politikberater bzw. verdeckten Lobbyisten ansetzen: Argumente wie nationale/regionale Autonomie versus ‚Welt-Regierung‘ und wahrscheinlicher Verlust der Abgeordneten-Diäten versus gesicherte soziale/monetäre Existenz der jetzigen Parlamentarier samt ihrer Familien könnten da erfolgreich eingesetzt werden.
Beispiel 2: Wir sollten fundiert wirkende Zweifel an der wissenschaftlichen Basis von Klima-Katastrophe und Exoplaneten-Eignung schüren, wie sie ja von der AKTION als Fakten vorgegeben werden. Ich verweise auf strukturell ähnliche Konflikte in Sachen Atomkraft-Schädlichkeit, Handy-Strahlung, Glyphosat-Krebs, Mikroplastik, Erdgas-Fracking und Konzern-Schiedsgerichte, die wir mit verwandten Mitteln positiv bewältigt haben.“
Jetzt verstärkter, anhaltender Beifall. Der Vorsitzende lächelt verhalten, erteilt der nächsten Rednerin das Wort:
„Ja, all das geht in die richtige Richtung, aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass die Schlacht um die Gehirne und damit auch die Wählerstimmen über sämtliche Medien tobt und dort letztlich entschieden wird. Die AKTION hat aufgrund ihrer derzeit überragenden Internet-Kompetenz und Präsenz dort ihre stärkste Bastion. Aber wir kontrollieren institutionell, finanziell, technisch und personell die internationalen Web-Zentren. Lassen Sie uns deshalb mit unseren Netz-Experten sämtliche Möglichkeiten der Überwachung, der Datenkontrolle und -steuerung, der Gebühren-Erhöhung, der technischen Störung, aber auch von sach- und personenbezogenen Falschinformationen sowie die Unterwanderung der zwölf agierenden Internet-Communities der AKTION eruieren und planvoll einsetzen. Damit greifen wir den sogenannten ‚basisdemokratischen‘ Denk- und Kommunikationsprozess der AKTION in seinen Wurzeln an.“
Fast alle am Tisch Sitzenden nicken oder klopfen beifällig, eine zunehmend gehobene Stimmung breitet sich aus, während man dem vorerst letzten Beitrag folgt:
„Und wenn wir die vielen einzelnen Erdenbürger aus der Grundstimmung der Bedrohtheit und Hoffnungslosigkeit herausholen wollen, die den enormen Erfolg der AKTION bis hierher ermöglicht hat, dann müssen wir sehr, sehr viel bisher inaktives Kapital – im Notfall die gesamten stillen Reserven – in eine schnelle Verbesserung der konkreten Lebensqualität für die Massen investieren. Das heißt zum Beispiel: flächendeckende, sozial gestufte Subventionierung aller Energiepreise zur Bezahlbarkeit von Mobilität, Kühlung/Heizung und Automatisierung für jedermann; geballter Ausbau aller emissionsfreien Energieträger ohne eigene Rendite-Erwartung; freie Altersversorgung im Gegenzug zum Verzicht auf Kinder zwecks Umkehrung des rasanten Bevölkerungswachstums; Freigabe sämtlicher durch uns vom Markt weggekaufter Patente in Sachen Klimaschutz, Ökologie, Verkehr, Landwirtschaft, Gesundheit, Chemie/Pharma/Medizin und Ähnlichem. Damit können wir wahrscheinlich ‒ direkt über die Bürger ‒ der AKTION die Führungsrolle bei der Realisierung der von ihr definierten Menschheitsziele nehmen. Vielleicht locken wir so ja auch die AKTIONisten direkt unter unsere Fittiche?“
Allgemeine Heiterkeit, verhaltenes Lachen, lang anhaltender Beifall, der vom befriedigt strahlenden Vorsitzenden Don Myers behutsam gedämpft wird. Nach weiteren Redebeiträgen verkündet er schließlich den Schluss der Sammlungsphase, verweist auf das im Speisesaal wartende „exquisite chilenisch-planetarische Menü“. Und: „Nach dieser Arbeitspause können Sie die inzwischen von unserem Exekutivbüro schriftlich aufbereiteten Vorschläge in Ruhe studieren, um Ihre Positionen und Fragen zu formulieren. Während der zweiten Konferenz-Phase in der morgigen Vormittagssitzung werden wir sämtliche Ideen kritisch diskutieren und auf ihre Erfolgschancen und Kosten hin bewerten. Und morgen Nachmittag sollten wir – gegebenenfalls nachdem Sie notwendige Rückfragen an Ihre Institutionen, Vereinigungen, Unternehmen getätigt haben – zur Abstimmung kommen. Die von diesem Plenum mehrheitlich akzeptierten Maßnahmen der GESELLSCHAFT sind danach – entsprechend unserem Gesellschaftsvertrag ‒ für alle Mitglieder verbindlich. – Vielen Dank!“
Als am Abend des folgenden Tages im Hotel-Foyer zum Abschied wieder Champagner und Whisky angeboten werden, führen alle Tagungsteilnehmer in Ihren Lederköfferchen einen Datenträger samt Papierausdruck mit sich. Die enthaltene Datei trägt die Überschrift:
Die GESELLSCHAFT schlägt zurück.
Wie die Pläne und Tätigkeiten der AKTION LEBEN neutralisiert werden sollen.
Strengstens vertraulich!